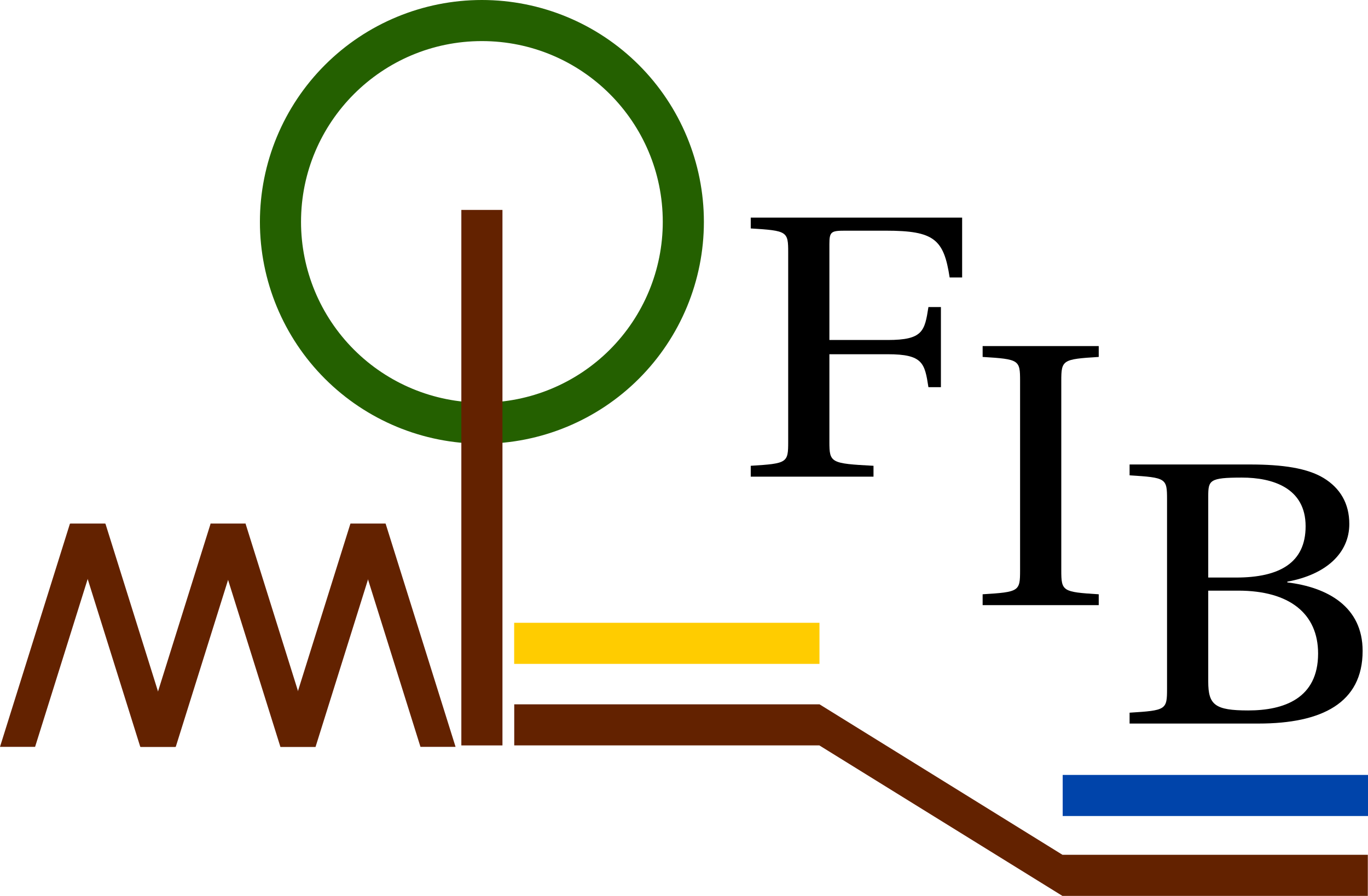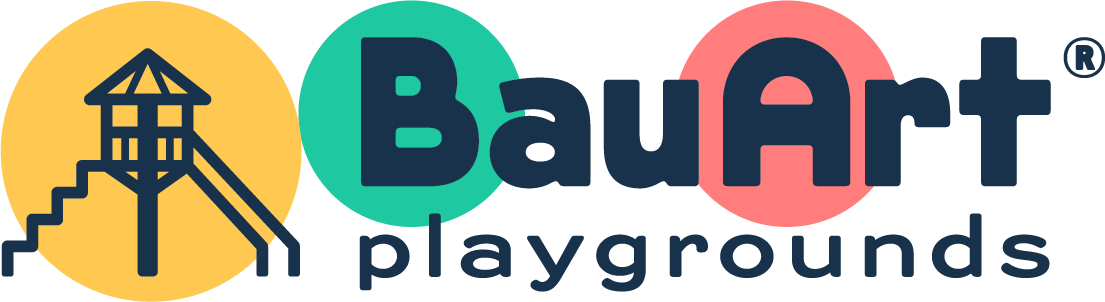Robi
Die Robinie als Rohstoffpflanze für industrielle Anwendungen
01.7.2025 – 31.12.2026
Koordination und Ansprechpartner
- Dr. Bert Volkert
- Abteilungsleiter Mikroverkapselung und Polysaccharidchemie
- Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP
- Synthese- und Polymertechnik
- Telefon: +49 331 568-1516
- E-Mail: bert.volkert@iap.fraunhofer.de
- Robi-Webseite: https://www.iap.fraunhofer.de/de/Projekte/robi.html
- Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP, Potsdam
Das IAP widmet sich den Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft – ob Klimawandel, Pandemien, Energiewende, Strukturwandel oder neue Mobilitätskonzepte.
Dr. Bert Volkert, bert.volkert@iap.fraunhofer.de - Forschungsinstitut für Bergabaufolgelandschaften e.V. , Finsterwalde
Das FIB beschäftigt sich mit den durch Rohstoffgewinnung geschädigten Landschaften, insbesondere im Lausitzer Braunkohlerevier.
Dr. Christian Lange, c.lange@fib-ev.de - SIK-Holzgestaltungs GmbH, Niedergörsdorf & BauArt-Playgrounds GmbH, Welzow
Dipl.-Holzwirt Marc Oelker, oelker@sik.de
Kurzbeschreibung und Ziele
Weltweit zählt die nordamerikanische Robinie (Robinia pseudoacacia L.) zu den leistungsstarken, vielseitigen und mit 3,25 Millionen Hektar Anbaufläche am häufigsten kultivierten Baumarten.
Rund zwei Drittel der Anbaufläche in Deutschland entfallen auf Brandenburg, mit steigender Tendenz. Hier gilt sie wegen ihrer hohen Dürre- und Hitzetoleranz als robuste „Zukunftsbaumart“, gerade auf armen Sandböden der Lausitzer Altmoränenlandschaft.
Während gebietsheimische Baumarten an Vitalität einbüßen, überzeugt die Wuchskraft der Robinie. Unschlagbar sind die holzphysikalischen und -technologischen Eigenschaften. Gleichzeitig punktet das „Teakholz Brandenburgs“ mit seiner stofflichen Qualität: Wie keine andere Baumart enthält die Robinie bis zu 6 Prozent der Trockenmasse an hochwertigen Extraktstoffen – ein Spitzenwert unter allen Industriepflanzen. Dabei sind ihre biochemischen Muster von vielen Faktoren abhängig, komplex und sehr variabel.
Bisher erfolgt keine systematische Erfassung der Holzinhaltsstoffe/Feinchemikalien von Robinien für eine industrielle Nutzung in hochwertigen Chemiegrundstoffen, spezifischen Wirkstoffen und Folgeprodukten. Die nutzbaren Potenziale sind unklar, sowohl bei Wald- als auch Agrarholz. So werden die wenigen Robinien-Aufwüchse von Kurzumtriebsplantagen bislang (fast) ausschließlich energetisch verwertet.
Das Projekt „Robi“ zielt auf eine industrielle Nutzbarmachung der Robinien-Inhaltsstoffe, sowohl der Extraktstoffe z. B. als biologischen Holz- und Pflanzenschutz als auch der Holzhauptbestandteile (Cellulose, Lignin, Hemicellulose) für diverse Anwendungen.

Projektinnovation
Insbesondere für den Absatz von gering dimensioniertem Schwachholz lassen sich neue Einkommensmöglichkeiten erwarten. Diese neuen Einkommensmöglichkeiten und insgesamt höhere Holzerlöse − schon bei der frühen Bestandspflege − motivieren zu einer konsequenten Bewirtschaftung.
Daneben finden vorkonzentrierte Abfälle der robinienverarbeitenden Sägewerke in Deutschland bisher keine angemessene stoffliche Verwertung. Gerade die mineralstoffreiche Baumrinde ist ein ungelöstes „Entsorgungsproblem“, bleibt doch ihre Verbrennung wegen des hohen Ascheanfalls schwierig. So lassen sich durch „Robi“ jetzt neue, bisher brachliegende, unterbewertete oder unvermutete Rohstoffpotenziale für die industrielle Weiterverwertung erschließen.
Durch verfahrensorientierte Anwendungsforschung leistet „Robi“ einen originären Beitrag zur Strukturentwicklung in der Lausitz und anderen durch Agrar- und Forstwirtschaft geprägten ländlichen Räumen. Die Zielregion Lausitz ist in weiten Teilen land- und forstwirtschaftlich geprägt. Damit trägt die Bereitstellung biologischer Ressourcen zur regionalen Wertschöpfung und Arbeitsplatzsicherung bei. Eröffnen sich doch durch innovative Biomasserohstoffe bzw. Wertschöpfungsketten neue Entwicklungsperspektiven. So verstanden, kann Bioökonomie einen wertvollen Beitrag zur Strukturentwicklung leisten.
Nachhaltige Landnutzung und Bioökonomie
Kurzumtriebsplantagen werden allgemein als nachhaltig angesehen, da sie zur Bodenverbesserung, Kohlenstoffbindung und zum Bodenschutz beitragen sowie den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie Dünger meist minimieren sowie eine Quelle für erneuerbare Energie darstellen. Sie verbessern das Mikroklima und können zudem neue Lebensräume für bestimmte Tier- und Pflanzenarten schaffen. Da „Robi“ die möglichst vollständige Verwertung aller kommerziell interessanten Inhaltsstoffe des Robinienholzes umfasst, wird die Ressourcennutzung noch effizienter.
„Robi“ verbindet eine ganzheitlich-stoffliche Verwertung aller kommerziell interessanten Inhaltsstoffe von Robinienholz mit neuen Impulsen für die Landnutzung: Das betrifft (1) den Agrarholzanbau landwirtschaftlicher Grenzertragsböden außerhalb der Lebensmittelerzeugung, wie auch (2) die Verwertung von ungenutztem Restholz im Wald und (3) in der Sägeindustrie. Es ergeben sich zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten des Rohstoffes in kommerziellen Produktionsmodellen, auch als Mischverwertung − ohne Konkurrenz mit etablierten „Holzketten“ in Brandenburg.
Die Rest- und Vollbaumholzverwertung kann vielen Landnutzern neue Anbauperspektiven erschließen, insbesondere im „low-input“-Agrarholzanbau auf marginalen Böden.
Durch konkrete, auf die Gewinnung von Holzinhaltsstoffen ausgerichtete Anbauempfehlungen leistet das Projekt einen Beitrag zur Belebung des plantagenartigen Anbaus der Robinie, außerhalb der landwirtschaftliche Flächenkonkurrenz, etwa auf Rekultivierungsflächen des Bergbaus und sanierungsbedürftigen Altlasten, Deponien oder anderweitig nur schwer kultivierbaren Brach- und Sonderflächen.
In ertragsschwachen Landbaugebieten und auf Sonderstandorten kann der Anbau von Robinie als inhaltsstoffreiche Biomasse eine wirtschaftlich lohnende Produktionsalternative werden. Voraussetzung ist, dass dadurch regionale Verarbeitungskapazitäten entstehen, die ihrerseits eine stabile Produktionsgrundlage mit planbarem Holzaufkommen benötigen, etwa auf Grundlage des Vertragsanbaus.

Ausblick
In einer nächsten Stufe können die im Projekt modifizierten bzw. eigens entwickelten Methoden zur Prozessführung − effiziente Gewinnung, Feinfraktionierung, Aufreinigung und Modifikation der spezifischen Robinien-Inhaltsstoffe − auf flächenmäßig bedeutsamere Gehölze übertragen werden. Zwei Beispiele sind die kernholzreiche Trauben- und Stiel-Eiche, als wichtige Zielbaumart im klimafesten Waldumbau der Modellregion. Es ist davon auszugehen, dass in den Forstbetrieben bei Pflegeeingriffen künftig vermehrt schwach dimensioniertes Laubholz anfällt, was sich bisher kaum kostendeckend vermarkten lässt, trotz steigender Holznachfrage.