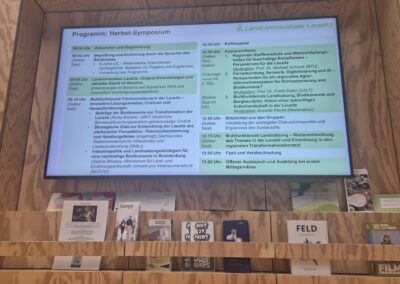Land-Innovation-Lausitz Herbst-Symposium 2025
Multifunktionale Flächennutzung und nachhaltige Wertschöpfung in der Lausitz

25.11.2025
Beim Herbst-Symposium von „Land-Innovation-Lausitz“ am 20. November stand die multifunktionale Flächennutzung und nachhaltige Wertschöpfung in der Lausitz im Mittelpunkt. Zum fachlichen Austausch zu diesem Thema kamen Interessierte aus Landwirtschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft im Gründungszentrum Startblock B2 auf dem Zentralcampus der BTU in Cottbus zusammen. Im Fokus spannender Diskussionen standen u.a. innovative Lösungsansätze und Erkenntnisse aus der anwendungsnahen Forschung zu Verfahren und Technologien der multifunktionalen Flächennutzung in der Lausitz sowie die damit verbundenen Chancen für die Region.
Die Sprecher des Bündnisses Prof. Dr. Michael Schmidt vom Fachgebiet Umweltplanung an der BTU Cottbus-Senftenberg und Prof. Dr. Frank Ewert, Wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung, begrüßten die Teilnehmer der Veranstaltung. Zum Auftakt gaben sie einen kurzen Einblick in die durch LIL gewonnenen Erkenntnisse.
Zum Auftakt der Veranstaltung hatten Prof. Dr. Frank Ewert (ZALZ) und Prof. Dr. Michael Schmidt (BTU) sowie die Moderatorin Annette Riedel das Wort. © Sascha Thor | BTU
Die Teilnehmenden erwartete ein spannendes Veranstaltungsprogramm zu wichtigen Zukunftsfragen. © Tanja Kollersberger | ZALF
Einführend zum Thema reflektiert Dr. Romy Brödner, Leiterin der Arbeitsgruppe “Ressourcenmobilisierung für bioökonomische Aktivitäten“ am Deutschen Biomasse-Forschungszentrum (Leipzig), sowohl die Beiträge der Bioökonomie zur Transformation in der Lausitz als auch die Herausforderungen bei der Entwicklung von Wertschöpfungsnetzen rund um Biomasse.
Sabine Blossey, Leiterin des Referats „Bioökonomie“ im Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung, Umwelt, Verbraucherschutz (MLEUV) des Landes Brandenburg, gab mit ihrem engagierten Eröffnungsvortrag zu „Landnutzungsstrategien für eine nachhaltige Bioökonomie in Brandenburg“ einen Überblick zum aktuellen Stand der Bioökonomiestrategie des Landes Brandenburg – nicht ohne Hinweis auf die aktuell bestehenden Unsicherheiten, aber auch die immensen Chancen, die im zentralen Thema der Veranstaltung liegen.
Wichtige Themen sind nach Ansicht der Expertinnen unter anderem Mobilisierungsstrategien für biogene Ressourcen und Möglichkeiten für den Aufbau nachhaltiger Wertschöpfungsketten auf regionaler Ebene, aber auch die Zielkonflikte und Grenzen der Biomassenutzung. Da Bioökonomie in jeder Region anders funktioniert, wurde außerdem erörtert, an welchen Stellschrauben speziell in der Lausitz noch zu drehen ist, um die Potentiale der Biomassenutzung und Kreislaufwirtschaft tatsächlich nutzen zu können.
Parallele Austauschforen zur inhaltlichen Vertiefung
Nach der inspirierenden ersten Runde von Impulsvorträgen ging es dann in drei separate Foren, in denen sich die Teilnehmenden zu ausgewählten Themen der multifunktionalen Landnutzung austauschen konnten.
Im ersten Austauschforum zum Thema „Regionale Stoffkreisläufe und Wertschöpfungsketten für faserhaltige Nutzpflanzen – Perspektiven für die Lausitz“, moderiert von Prof. Dr. Michael Schmidt, ging es vor allem um die stoffliche Verwertung nachwachsender Rohstoffe, die (industrielle und landwirtschaftliche) Doppelnutzung faserhaltiger Biomasse sowie die integrierte Betrachtung der Erzeugerseite und Verarbeitung. Als Kristallisationspunkt zukünftiger Aktivitäten, speziell die industrielle Fasernutzung, stellte Alexander Scharfenberg (ASG Spremberg) den Industriepark Schwarze Pumpe vor, der sich aktuell besonders dynamisch entwickelt und gerade beim Thema Bioökonomie einzigartige Synergien bietet. Klaus Gutser (ZALF) stellte die Möglichkeiten der Produktion faserhaltiger Nutzpflanzen in einem kreislauforientierten Anbausystem vor – und skizzierte den notwendigen Paradigmenwechsel bei der Umstellung der landwirtschaftlichen Produktion auf Basis nachhaltig bodenverbessernder Fruchtfolgen. Hermann Dauser (fibers365) zeigte, wie Fasern aus Nutzpflanzen verfahrenstechnisch schonend gewonnen werden können – mit teils erstaunlich hoher Qualität. Abschließend stellte Jens Balko (IAP Fraunhofer) den aktuell intensiv beforschten Bio-Kunststoff Polybutylen-Succinat vor, der auf Basis von Zucker (d.h. indirekt auch Zellulose) produziert werden kann, und der – biologisch vollständig abbaubar – Polyethylen in vielen Bereichen ersetzen kann. In der anschließenden, äußerst angeregten Diskussion ging es um die Rohstoffpotentiale und wie diese effizient und mit größtmöglicher Synergie genutzt werden könnten.

Alexander Scharfenberg (ASG Spremberg, Förderung & Vermarktung, Industrieparkmanagement & Standortentwicklung) stellt den Industriepark Schwarze Pumpe vor (rechtes Bild). Prof. Dr. Michael Schmidt (BTU) moderierte das dritte Austauschforum. © Sascha Thor | BTU

Beim zweiten Austauschforum zum Thema „Fernerkundung, Sensorik, Digitalisierung und KI – Komponenten für ein regionales Agrarinformationssystem für Klimaanpassung und Bioökonomie?“ standen Verfahren und Technologien für die Landwirtschaft 4.0 sowie die Datengewinnung und -bereitstellung für landwirtschaftliche Nutzer/innen und weitere Fachbereiche im Mittelpunkt.
Karl-Heinz Dammer (Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB)) stellte in einem einführenden Impulsvortrag hierfür die Forschungsarbeiten am ATB zum ressourceneffizienten und klimaangepassten Pflanzenschutz mithilfe von Sensorik, Robotik und KI vor.
Der Schwerpunkt des zweiten Impulsvortrags von Nicole Köllner (GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung) lag in der Fernerkundung, KI und Automatisierung, insbesondere den Tools und Methoden für ein modernes Landschaftsmonitoring und der effizienten und nachhaltigen Flächennutzungsplanung.
Lars Frickes (Hochschule Neubrandenburg) Fokus lag auf dem automatischen Monitoring von Bestandsentwicklung und Ermittlung von kleinräumigen Ertragspotentialen mittels freier Satellitendaten und KI-Modellen.
Die Session und anschließende, spannende Diskussion rund um die Herausforderungen, Übernahme der Landtechnikindustrie, Preisgestaltung bezüglich einer möglichen Verstetigung moderierte Prof. Dr. Frank Ewert.

Linkes Bild: Dr. Karl-Heinz Dammer (ATB) beantwortet Fragen zur 3 Chip-Kamera einer Drohne zur Einsparung von Pflanzenschutzmitteln und Geldern. Rechtes Bild: Nicole Köllner (GFZ) stellt die Ergebnisse des LIL-Projekts LauMon Monitoring der Landschaftsraumoberflächen und Biodiversität mittels Drohnen- und Satellitendaten in der Modellregion Lausitz vor. © Sascha Thor | BTU

Moderatorin Annette Riedel führte durch das dritte Austauschforum mit dem Titel „Multifunktionale Landnutzung, Bioökonomie und Bergbau-Erbe: Vision einer zukünftigen Kulturlandschaft in der Lausitz“, das folgende drei Schwerpunkte beinhaltete: (i) Innovative Anbausysteme, (ii) Landwirtschaftliche Nutzung in Kombination mit Energieerzeugung oder stofflicher Verwertung von Pflanzenbestandteilen oder Bereitstellung von Ökosystemleistungen und (iii) Verknüpfung von Tagebaufolgelandschaft und Bioökonomie.
Lea Brönner und Mareike Herold (Institute for Heritage Management, Cottbus) eröffneten das Forum mit ihrem Beitrag zum Wandel mit Wurzeln – wie das kulturelle Erbe die Landschaftstransformation in der Lausitz mitgestaltet.
Alle weiteren Impulsvorträge drehten sich um das Thema Energie in der Lausitz:
„Land schafft Energie – neue Perspektiven für die Landwirtschaft“ war der Titel des Impulsvortrags von Maik Veste (Centrum für Energietechnologie Brandenburg). Bei ihm stand die Photovoltaik – Freiflächenanlagen und Biodiversität sowie Agri-Photovoltaik – im Vordergrund. Auf die „Energiewende von und durch Bürgerhand“ ging Dirk Marx (BTU, Lehrstuhl Öffentliches Recht, insbesondere Umwelt- und Planungsrecht) in seinem Vortrag ein. Der Beitrag von Max Heidenreich (Next2Sun) widmete sich den „Chancen von vertikaler PV für mehrere Flächennutzungen, insbesondere Agri-PV“. Schließlich berichtete Hans-Joachim Mautschke (Gut Krauscha) aus der Sicht eines Landwirtschaftsbetriebs über die Kombination von Ackerbau und Solarenergieerzeugung in der Praxis.
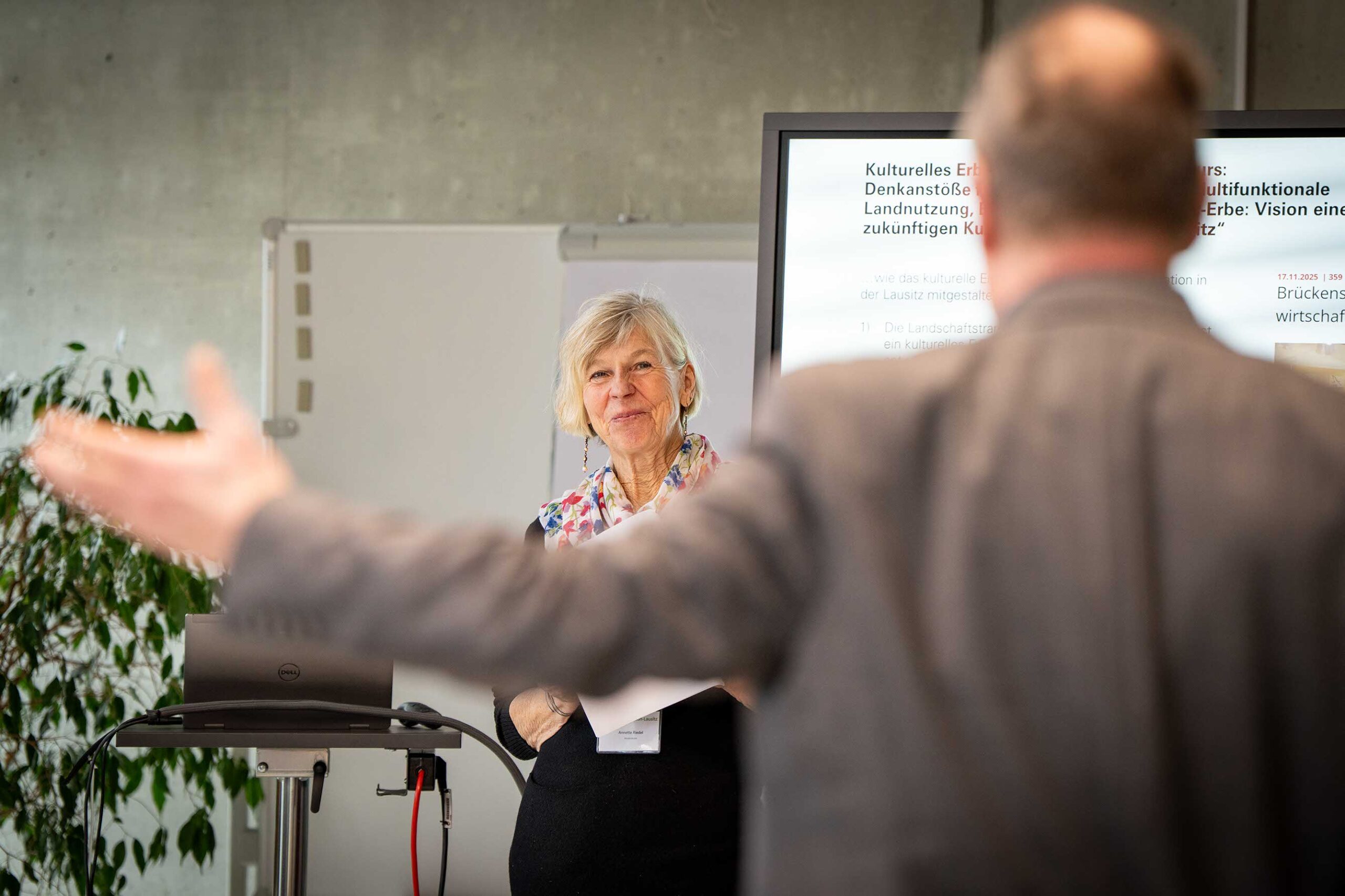

Impressionen aus dem dritten Austauschforum: In diesem Forum ging es um innovative Anbausysteme, landwirtschaftliche Nutzung in Kombination mit Energieerzeugung oder stofflicher Verwertung von Pflanzenbestandteilen oder Bereitstellung von Ökosystemleistungen und Verknüpfung von Tagebaufolgelandschaft und Bioökonomie © Sascha Thor | BTU


Anschließend ordneten Romy Brödner (DBFZ), Sabine Blossey (MLEUV), und Stefan Zundel (Prof. em. für Angewandte Volkswirtschaftslehre an der BTU Cottbus-Senftenberg und Leiter der Begleitforschung zum Strukturwandel in der Lausitz) die Fragestellungen und Erkenntnisse rund um die Bioökonomie in den regionalen Kontext der Nachhaltigkeitstransformation und die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen ein.
Prof. Dr. Schmidt und Prof. Dr. Ewert hatten das abschließende Wort und luden zum gemeinsamen Mittagsbuffet ein.

Das Gespräch zur Multifunktionalen Landnutzung – Perspektiven in der Lausitz und Einordnung in den regionalen Transformationskontext moderierte Annette Riedel. Das Schlusswort hatten Prof. Dr. Schmidt und Prof. Dr. Ewert. © Tanja Kollersberger | ZALF